Dachdämmung: Energiekosten senken und Komfort steigern

Möchten Sie Energie sowie Heizkosten einsparen und Ihren Wohnkomfort steigern? Dann ist die Dachdämmung eine effektive und zugleich wirtschaftlich interessante Maßnahme. Welche Vorteile diese bringt, wie Sie die Dachdämmung umsetzen und wie Ihnen der Staat dabei mit Förderung unter die Arme greift, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.
Die Dämmung der Dachflächen bringt viele Vorteile
Mit einer Dachdämmung wirken Sie dem Wärmeverlust über die Dachflächen entgegen. Sie senken Ihren Energieverbrauch und profitieren von geringeren Heizkosten. Im Sommer hilft die Maßnahme zudem dabei, den Wärmeeintrag von außen zu reduzieren. Ihr Haus heizt sich langsamer auf und Sie müssen weniger kühlen. Darüber hinaus sorgt das Dämmen der Dachflächen für einen kleineren CO2-Fußabdruck. Es wirkt störender Zugluft entgegen und steigert den Wert Ihres Hauses.
Sinnvoll ist die Dachdämmung dabei immer dann, wenn der Dachraum beheizt ist oder Sie planen, diesen auszubauen. In allen anderen Fällen empfiehlt sich alternativ eine Dachbodendämmung. Diese ist günstiger und mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst durchführbar.
Unser Tipp: Planen Sie weitere Sanierungsarbeiten am Haus oder möchten Sie den Dachraum Ihren Wünschen entsprechend ausstatten? Gern unterstützen wir Sie dabei!
In diesen Fällen wird die Dachdämmung zur Pflicht
Befinden sich bisher weder auf dem Dachboden noch an den Dachflächen Dämmstoffe? Dann fordert das Gebäudeenergiegesetz (GEG) entsprechende Maßnahmen. Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, können Sie entweder die oberste Geschossdecke oder das Dach selbst auf einen U-Wert von 0,24 W/m2K bringen. Von der Pflicht ausgenommen sind Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern, die diese schon am 01. Februar 2002 als Eigentümer selbst bewohnt haben. Trifft das in Ihrem Fall zu, müssen sich erst neue Eigentümer um die Dachdämmung kümmern.
Eine weitere Dämmpflicht greift, wenn Sie mehr als zehn Prozent der Dachfläche erneuern, ersetzen oder erstmalig neu aufbauen. In diesem Fall schreibt der Gesetzgeber für die entsprechenden Flächen einen U-Wert von 0,24 W/m2K vor. Davon abweichen können Sie, wenn die Dämmschichtdicke aus technischen Gründen begrenzt ist. Dann genügt es, die maximal mögliche Stärke eines Dämmstoffs der WLG 035 einzubauen. Wurden die Bauteilflächen nach dem 31. Dezember 1983 entsprechend den energiesparrechtlichen Vorschriften errichtet oder erneuert, gilt die Pflicht zur Dachdämmung nicht.
Verschiedene Dämmverfahren stehen zur Auswahl
Planen Sie eine Dachdämmung, können Sie sich für eine Auf-, Zwischen- oder Untersparrendämmung oder eine Kombination mehrerer Dämmvarianten entscheiden. Haben Sie ein Flachdach, stehen mit dem Warm- und Umkehrdach ebenfalls zwei Konstruktionen zur Wahl. Die folgende Übersicht zeigt, was die einzelnen Lösungen auszeichnet.
- Aufsparrendämmung: Bei dieser Variante bringen Fachhandwerker die Dachdämmung außen auf den Sparren auf. Direkt unter der Eindeckung entsteht dabei eine starke sowie ebene Fläche, die ohne Wärmebrücken auskommt und einen hohen Wärmeschutz bietet. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie das Dach neu eindecken, was neben höheren Kosten auch einen erhöhten Aufwand verursacht.
- Zwischensparrendämmung: Die Zwischensparrendämmung lässt sich von innen einbringen. Sofern eine vor Wind- und Wetter schützende Unterspannbahn vorhanden oder nachrüstbar ist, klemmen Handwerker die Dachdämmung dabei zwischen die Sparren. Raumseitig folgt eine luftdichte Ebene, unter der eine Lattung die neue Deckenverkleidung hält. Ein Nachteil ist, dass die Dämmstärke häufig von der Stärke der Sparren abhängt. Denn für eine Sparren-Aufdopplung ist nicht immer genügend Platz. Eine Zwischensparrendämmung ist auch ergänzend zur Aufsparrendämmung möglich. In diesem Fall wird vor der Aufsparrendämmung von außen eine Dämmung zwischen den Sparren eingebracht und damit die Dämmwirkung der Dachdämmung insgesamt gesteigert.
- Untersparrendämmung: Entscheiden Sie sich für eine Untersparrendämmung, befindet sich die Dämmebene raumseitig unter den Dachsparren. Sie lässt sich ebenfalls nachträglich von innen anbringen und ist häufig schlanker als die anderen Varianten. Ein Grund, aus dem Fachhandwerker diese Art der Dachdämmung häufig mit einer Zwischensparrendämmung kombinieren.
- Flachdachdämmung: Haben Sie ein Flachdach, lassen sich die Dämmstoffe oberhalb oder unterhalb der Dachabdichtung einbringen. Im ersten Fall sprechen Experten von einem Umkehrdach. Befinden sich die Dämmstoffe auf dem Tragwerk und unter der Abdichtung, handelt es sich hingegen um ein Warmdach.
Haben Sie ausreichend große Hohlräume im Dach, kommt auch eine Einblasdämmung infrage. Dabei blasen Fachhandwerker körnige oder flockige Dämmstoffe über kleine Löcher in den Dachaufbau ein. Das ist effektiv, günstig und ohne größeren baulichen Aufwand umsetzbar.
Bei der Dachdämmung auf die Luftdichtheit achten
Dichten Sie mehr als ein Drittel der Dachflächen ab, kann sich das auf den Feuchtehaushalt des gesamten Gebäudes auswirken. Aus diesem Grund fordert der Gesetzgeber mit der DIN 1946 Teil 6 ein entsprechendes Lüftungskonzept. Experten prüfen dabei, ob die natürliche Lüftung zum Feuchteschutz nach wie vor sichergestellt ist oder ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Ist letzteres der Fall, gibt es verschiedene Varianten der freien und Ventilator-gestützten Lüftung. Diese sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden wie Schimmel sicher zu verhindern.
Mit attraktiven Förderangeboten die Kosten senken
Auch wenn die Dachdämmung in vielen Fällen wirtschaftlich ist, fallen doch erst einmal hohe Kosten an. Mit einer Förderung vom Staat senken Sie diese um bis zu 20 Prozent. Möglich ist das etwa mit einem Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der sich mit einem günstigen KfW-Ergänzungskredit kombinieren lässt. Alternativ können Sie 20 Prozent der Sanierungskosten steuerlich geltend machen, und zwar dann, wenn Sie Ihr Haus selbst bewohnen. Beide Förderangebote setzen hohe technische Vorgaben voraus, die noch über den gesetzlichen Bestimmungen liegen. Es empfiehlt sich, für eine gute Planung am besten von Anfang an einen Energieberater in den Prozess einzubinden.
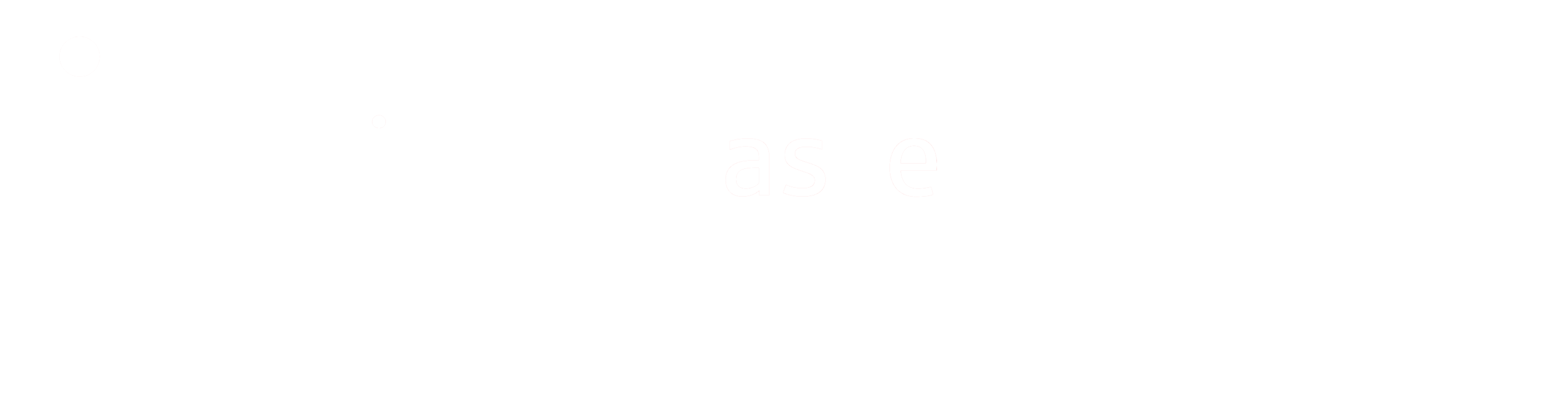







Schreibe einen Kommentar