PVT-Module: Wärme und Strom aus einer Solaranlage

Geht es um die Nutzung der Solarenergie, hatten Hausbesitzer bisher die Wahl zwischen Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Während die einen Wärme gewinnen, stellen die anderen elektrische Energie zur Verfügung. Wer beides für sich nutzen möchte, kann heute PVT-Module installieren. Diese vereinen die Strom- und Wärmeerzeugung auf derselben Fläche. Wir erklären, wie das funktioniert und wann sich der Einsatz von PVT-Solarmodulen lohnt.
PVT-Module kombinieren Photovoltaik und Solarthermie
Die Abkürzung PVT steht für Photovoltaik und Thermie und beschreibt Solarmodule, die Strom und Wärme auf derselben Fläche ernten. Die zur Sonne ausgerichtete Oberfläche der PVT-Module ist dazu mit Photovoltaikzellen belegt. Diese wandeln das auftreffende Licht in Strom um, der sich dann im eigenen Haus verbrauchen oder in das öffentliche Netz einspeisen lässt. Die Besonderheit liegt auf der Rückseite: Hier sitzen Wärmeübertrager, welche die Abwärme der Module auf eine Solarflüssigkeit übertragen. Diese erwärmt sich und transportiert die aufgenommene Energie zu einem Speicher im Haus. Hier lässt sich die Wärme dann zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung nutzen.
Übrigens: Neben flüssigkeitsbasierten PVT-Modulen gibt es auch luftbasierte Systeme. Bei diesen erwärmt sich unter den Modulen vorbeiströmende Luft, die sich anschließend zur Beheizung des Gebäudes oder zum Betrieb einer Wärmepumpe nutzen lässt. Da Luft weniger Wärme speichern kann, ist der Einsatz flüssigkeitsbasierter Solarmodule jedoch effektiver. Nicht zu verwechseln sind die kombinierten Module außerdem mit Hybrid-Kollektoren. Bei diesen sind Solarzellen und solarthermische Kollektoren nebeneinander angeordnet. Dadurch steigt die Betriebstemperatur der PV-Module und die Effizienz der Stromerzeugung sinkt.
Vorteile und Nachteile der besonderen Solarkollektoren
Erwärmen sich Photovoltaikzellen im laufenden Betrieb, erzeugen sie aufgrund physikalischer Effekte weniger elektrische Energie. PVT-Module lösen dieses Problem, indem die Wärmeübertrager auf der Rückseite zur Kühlung der Solarzellen beitragen. Die Anlagen gewinnen dadurch mehr Strom und nutzen dieselbe Fläche gleich doppelt aus. Insgesamt erreichen sie dadurch einen messbar höheren Nutzen.
Der größte Nachteil liegt dabei in den Kosten. Zudem ist die Technik komplexer als reine PV- oder Solarthermie-Kollektoren und dadurch auch aufwendiger in Gebäude zu integrieren. Wichtig für einen hohen Nutzen ist außerdem, dass sich die gewonnene Wärme sinnvoll verbrauchen lässt. Möglich ist das zum Beispiel zur Warmwasserbereitung und/oder zur Heizungsunterstützung.
Einsatz: PVT-Module und Wärmepumpe für die Heizung
Die kombinierten Solarmodule kommen grundsätzlich auf jedem Dach infrage, das sich für die Nutzung der Solarenergie eignet. Voraussetzungen dafür sind eine günstige Orientierung (Ost bis West), eine passende Neigung (30 bis 40 Grad) sowie eine weitestgehend unverschattete und freie Dachfläche. Zu empfehlen sind PVT-Module dabei, wenn der Platz zu knapp ist, um eine Solarthermie- und eine Photovoltaikanlage zu installieren.
Interessant ist zudem die Kombination der PVT-Module mit einer Wärmepumpe. Während die auf der Modulrückseite abgenommene Wärme dabei das Trinkwasser erwärmt, liefern die Solarzellen auf der Vorderseite Strom für die Umweltheizung. Diese lässt sich ohne Warmwasserbereitung sparsamer betreiben. Zudem sinken die Heizkosten, da ein Teil des benötigten Stroms vom eigenen Dach kommt.
Übrigens: Planen Sie weitere Sanierungsmaßnahmen oder überlegen, im gleichen Zuge das Dach zu sanieren? Wir unterstützen Sie gern dabei!
Attraktiv: Hohe Zuschüsse zur Förderung der Photovoltaik
Anders als für reine Photovoltaikanlagen vergibt der Staat für PVT-Module eine attraktive Förderung. Genau wie Solarthermieanlagen bekommen Sanierer für diese Zuschüsse in Höhe von 30 bis 70 Prozent über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Voraussetzung ist, dass sie die kombinierten Solarmodule als Wärmeerzeuger (Solarthermie) oder als Wärmequelle für eine Wärmepumpe einsetzen. Außerdem sind die Fördermittel vor Maßnahmenbeginn online über das KfW-Zuschussportal zu beantragen. Wer diesen Zeitpunkt bereits verpasst hat, kann nachträglich den Steuerbonus für die Sanierung in Anspruch nehmen und 20 Prozent der Sanierungskosten verteilt über drei Jahre von der Steuer absetzen.
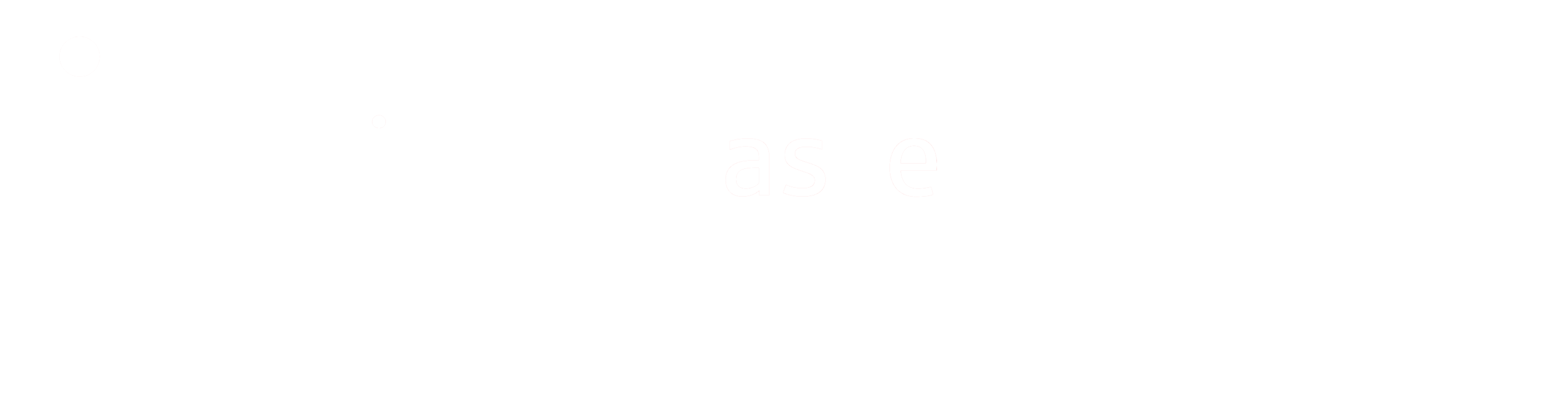






Schreibe einen Kommentar