Kellerdeckendämmung: Kosten sparen und Komfort steigern

Die Kellerdeckendämmung ist eine günstige Maßnahme, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu steigern. Sie reduziert die Wärmeverluste an Kellerräume, spart Heizkosten und sorgt zudem für einen höheren Komfort. Doch wann lohnt sich die Maßnahme? Welche Dämmstoffe kommen infrage und wie fördert der Staat die Kellerdeckendämmung?
Darum lohnt sich die Kellerdeckendämmung
10 bis 15 Prozent: So hoch ist der Anteil Ihres Heizenergiebedarfs, den allein Verluste über die Kellerdecke verursachen. Das gilt, wenn der Keller dauerhaft unbeheizt ist, und bietet große Einsparpotenziale. So hilft eine Kellerdeckendämmung, die Wärmeverluste an ungenutzte Kellerräume zu reduzieren. Die Folge sind spürbar sinkende Heizkosten. Aber nicht nur das: Durch die Dämmung der Kellerdecke kühlen die Böden im Erdgeschoss langsamer aus. Sie behalten warme Füße und steigern Ihren Komfort. Darüber hinaus verbessern Sie die Energieeffizienzklasse Ihres Gebäudes. Sie heben den Immobilienwert an und verkleinern durch geringere Verbrauchswerte Ihren CO₂-Fußabdruck.
Übrigens: Planen Sie weitere Sanierungsmaßnahmen oder überlegen, den Keller auszubauen? Wir unterstützen Sie gern dabei!
GEG verpflichtet zur Dämmung der Kellerdecke
In einigen Fällen macht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Kellerdeckendämmung zur Pflicht. So zum Beispiel, wenn:
- Sie den Fußbodenaufbau auf der warmen Seite erneuern oder neu aufbauen
- Sie auf der kalten Seite der Kellerdecke eine Deckenverkleidung anbringen
Ausnahmen von der Pflicht zur Kellerdeckendämmung bestehen, wenn eine Maßnahme weniger als zehn Prozent der Bauteilfläche betrifft. Aber auch dann, wenn die Decke bereits den energiesparrechtlichen Vorgaben vom 01. Januar 1984 entspricht oder wenn die Stärke der Kellerdeckendämmung technisch begrenzt ist, gilt die Pflicht nicht. Im zuletzt genannten Fall ist es ausreichend, eine Dämmung so stark wie möglich einzubauen. Die Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Dämmstands muss dabei mindestens 0,035 W/mK betragen. Bei einer Einblasdämmung oder dem Einsatz natürlicher Dämmstoffe gilt ein Mindestwert von 0,45 W/mK.
Verschiedene Dämmstoffe kommen infrage
Planen Sie eine Kellerdeckendämmung, stehen verschiedene Dämmstoffe zur Auswahl. Während die einen mit hohem Wärmeschutz punkten, sind die anderen natürlichen Ursprungs oder besonders sicher im Falle eines Brandes. Die folgende Übersicht zeigt, welche Materialien sich eignen:
- Kunststoffdämmplatten aus EPS oder XPS: Polystyrol besteht aus stabilen Platten, die sich einfach an die Decke kleben oder dübeln lassen. Die Materialien sind günstig. Sie lassen sich unkompliziert verarbeiten und bieten einen guten Wärmeschutz. Ein Nachteil zeigt sich im Falle eines Brandes: Denn dann kann der Dämmstoff schmelzen und von der Decke tropfen.
- Kunststoffdämmplatten aus PU-Hartschaum: Polyurethan ist ebenfalls ein künstlich hergestellter Stoff. Er besteht aus Erdölen, bietet aber einen deutlich besseren Wärmeschutz. Auf diese Weise ist es möglich, auch bei geringen Stärken einen guten bis sehr guten U-Wert zu erzielen. Bei einem Brand verhält sich der Dämmstoff wie EPS oder XPS. Die Preise sind im Vergleich zu diesen höher.
- Mineralwolle (Stein- oder Glaswolleplatten): Mineralwolleplatten sind leicht. Sie lassen sich gut verarbeiten und bieten einen etwas besseren Wärmeschutz als Polystyrolplatten. Der Dämmstoff besteht aus recycelten oder natürlichen Rohstoffen und ist nicht brennbar. Er erfüllt höchste Brandschutzanforderungen und sorgt für eine gute Schalldämmung. Ist viel Feuchtigkeit im Spiel, eignet sich Mineralwolle nicht.
- Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaserplatten: Dämmplatten aus Holzfasern haben einen natürlichen Ursprung und bieten einen geringeren Wärmeschutz als Polystyrol. Anders als Mineralwolle ist das Material jedoch normal entflammbar, wodurch es hohe Brandschutzanforderungen unter Umständen nicht erfüllt. Nachteilig ist außerdem der höhere Preis.
Welcher Dämmstoff für die Kellerdeckendämmung infrage kommt, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn Feuchtigkeit keine Rolle spielt und es auf einen optimalen Brandschutz ankommt, eignet sich Mineralwolle. Bei geringen Deckenhöhen sorgen PU-Hartschaumplatten für einen optimalen Wärmeschutz. Und wenn es Ihnen um eine natürliche Dämmung der Kellerdecke geht, steht mit Holzfaserdämmplatten ein ökologischer Dämmstoff zur Wahl.
Die Kellerdeckendämmung richtig anbringen
Sind ausreichend große Hohlräume vorhanden, können Sie Dämmstoffe einblasen. Das ist sauber und schnell umsetzbar. In allen anderen Fällen ist es möglich, die Kellerdeckendämmung von oben oder unten zu montieren. Während ersteres in bewohnten Gebäuden sehr aufwendig ist, entscheiden sich Sanierer häufig für die Kellerdeckendämmung von unten. Experten kleben oder dübeln die Dämmplatten dabei an die Decke. Sie dämmen Kabel sowie Rohre ein, wenn sich diese nicht verlegen lassen und bringen auch an den angrenzenden Wänden einen Streifen Dämmung an. Letzteres verhindert das Entstehen von Wärmebrücken und sorgt für einen besseren Wärmeschutz.
Unser Tipp: Dokumentieren Sie die Lage von Kabeln und Leitungen, um diese bei späteren Arbeiten schnell wiederzufinden.
Staat fördert die Dämmung der Kellerdecke
Bevor Sie die Kellerdeckendämmung angehen, sollten Sie eine Förderung dafür beantragen. Diese gibt es in Höhe von 15 bis 20 Prozent über das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Voraussetzung ist ein U-Wert von 0,25 W/m2K und das Einschalten eines Energieberaters. Den U-Wert erreichen Sie zum Beispiel mit einer zwölf Zentimeter starken Dämmung der WLG 032 (z. B. Mineralwolle).
Alternativ steht Ihnen ein 20-prozentiger Steuerbonus für die Sanierung zur Verfügung. Diesen beantragen Sie nachträglich, auf Wunsch auch ohne Energieberater, über Ihre Einkommensteuererklärung. Halten Sie sich bei der Kellerdeckendämmung lediglich an den gesetzlichen Mindeststandard, können Sie alternativ 20 Prozent der reinen Handwerkerlohnkosten steuerlich geltend machen.
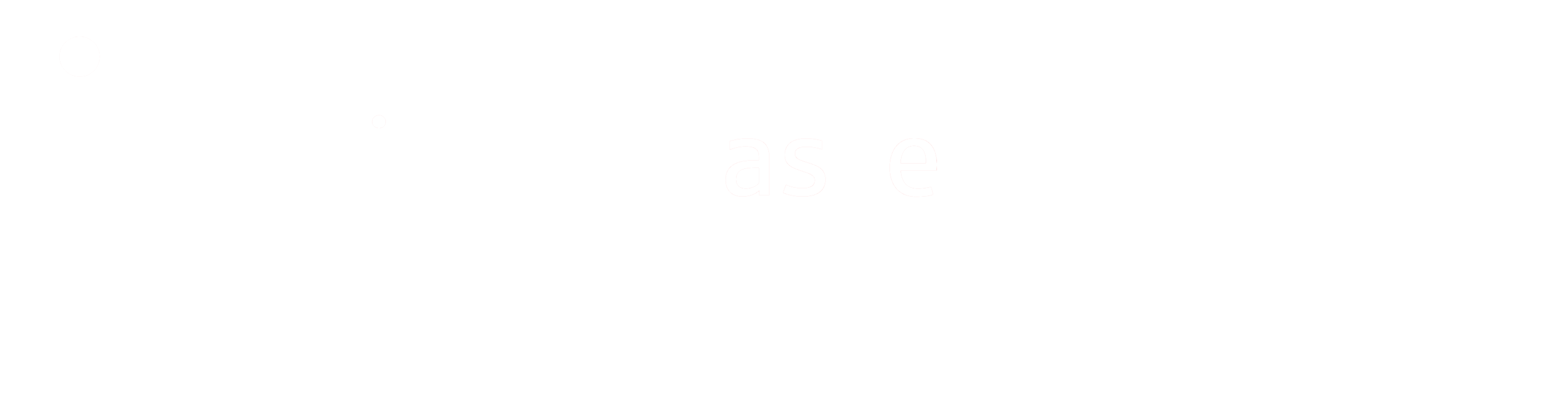






Schreibe einen Kommentar