DIE WELT IN EINEM SANDKORN

Mikrochips stecken heute überall drin: in Handys, Autos und Kühlschränken. Doch was genau können sie – und was kommt als Nächstes? Professor Albert Heuberger, Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IIS, erklärt, warum Chips das Herz moderner Technik sind, wie KI das Chipdesign verändert – und wo Europas Chancen in der Mikroelektronik liegen.
INTERVIEW: Peter Löwen
Herr Professor Heuberger, wenn wir auf den Stand der Technik blicken: Wie schlau sind Chips heute schon – und was wird in den Laboren gerade entwickelt, das morgen unseren Alltag verändern könnte?
Schlau sind Chips nicht von selbst. Aber: Je kleiner die Strukturen, desto mehr Transistoren passen hinein – aktuell bis hinunter zu zwei Nanometern, also zwei Milliardstel eines Meters. Damit laufen
komplexe Berechnungen sehr schnell, etwa für KI-Anwendungen. Ein moderner Chip ist bereits heute im Prinzip ein komplettes System auf wenigen Quadratmillimetern Silizium. Er vereint Milliarden von Transistoren, die Rechenleistung, Speicher,
Signalverarbeitung, Funkkommunikation und Sensorik auf engstem Raum ermöglichen. In der Forschung entstehen zum Beispiel Schaltungen, die nach dem Vorbild des Gehirns arbeiten. Solche Chips brauchen für die Ausführung von KI deutlich weniger Strom – Funktionen, die heute Rechenzentren vorbehalten sind, könnten so aufs Smartphone wandern.
Welche Trends sehen Sie noch?
Ganz vorn: die heterogene Integration – also verschiedene Chiptypen, die für mehr Tempo und Effizienz in einem einzigen System kombiniert werden, weil reines Schrumpfen der Strukturen an seine Grenzen stößt. Auch fürs Quantencomputing braucht es spezielle Materialien wie supraleitende Metalle, die mit klassischer Elektronik kombiniert werden. Bei uns hilft die Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland (FMD) dabei, solche Material- und Integrationsideen aus dem Labor in die Fertigung zu bringen.
Wie abhängig ist die Produktion von bestimmten Ländern oder politischen Lagen?
Während der Entwurf überwiegend in den USA und Europa stattfindet, sitzt ein großer Teil der Fertigung in Asien. Maschinen kommen vor allem aus den Niederlanden, den USA und Japan, Chemikalien ebenfalls aus Japan, aber auch aus Deutschland.
Geopolitische Spannungen, Exportregeln oder Sanktionen treffen deshalb auch die Produktion von Chips. Europa will mit dem
European Chips Act und Partnerschaften gegensteuern.
Der Wettlauf um die kleinste Strukturgröße auf einem Chip ist ein globales Hightech-Rennen. Können wir in Europa mit Asien und den USA mithalten?
Europa kommt heute nur noch auf rund acht Prozent der weltweiten Fertigung. Strukturen unter zehn Nanometern werden
derzeit in Asien und den USA produziert. Gleichzeitig ist Europa stark bei Leistungselektronik, Sensorik und optischen
Systemen. Und das Ganze ist eng verflochten: Ohne den niederländischen
Ausrüster ASML gäbe es die Technologie für Strukturen unter sieben Nanometern nicht. In Asien fertigt dann TSMC über 90 Prozent der fortschrittlichsten Chips; die USA liefern mit ihrer Grafikprozessor-Expertise führende KI-Beschleuniger. Das
zeigt, dass die Halbleiterindustrie global arbeitsteilig ist und keine Region alles allein kann. Zudem sind Fabriken extrem teuer und energiehungrig – neue Standorte entstehen meist nur mit staatlicher Unterstützung. Europa ist von seinem Ziel von 20 Prozent Marktanteil weiter entfernt denn je. Wichtiger ist es, die eigenen Stärken auszubauen, strategische Schlüsseltechnologien zu halten – und nicht weiter zurückzufallen.
Wie realistisch ist es, in Sachsen eine Art Silicon Valley für Chips zu errichten?
Überall in der Welt haben sich regionale Zentren für die Halbleiterproduktion herausgebildet. Und das mit Abstand größte Zentrum der Halbleiterproduktion in Europa ist in Dresden. Dort sitzen Infineon, GlobalFoundries und die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) – ein Joint Venture von TSMC, Bosch, Infineon und NXP. Dazu kommt ein starkes Umfeld aus Zulieferern und Forschung wie die TU Dresden und mehrere
Fraunhofer-Institute. Um die Chip- Produktion wirklich voranzubringen, braucht es Planungssicherheit und günstige Rahmenbedingungen, vor allem für Energiepreise. Dann können Firmen auch investieren. Aber genauso ist die Verfügbarkeit von Fachkräften eine wichtige Voraussetzung.
Warum ist der Bau einer neuen Chipfabrik so aufwändig und komplex?
Eine moderne Fabrik mit einer Kapazität von rund einer Million 300-mm-Wafern pro Jahr kostet zwischen zehn und 20 Milliarden Dollar, der Bau dauert drei bis vier Jahre. Tausende Fachkräfte, sehr viel Energie und Reinstwasser sind nötig. Gebaut werden hochstabile Reinräume mit sehr aufwendiger Klima- und Luftfiltertechnik, bestückt mit extrem präzisen Maschinen. Ein Chip entsteht in bis zu 1.000 Prozessschritten – Beschichten, Ätzen, Strukturieren, Polieren, Reinigen. Vom Rohwafer bis zum fertigen Bauteil vergehen bis zu vier Monate.
Wie eng arbeiten Forschung, Industrie und Politik bei der Chipentwicklung zusammen? Ist Europa da gut aufgestellt?
Die Zusammenarbeit in Europa ist so eng wie nie zuvor. Mit Initiativen wie dem EU Chips Act und der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland entsteht ein starkes Netzwerk, das Wissenschaft und Wirtschaft verbindet. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Trotzdem stehen wir im internationalen Vergleich immer noch vor größeren Herausforderungen als die USA und Asien, wo Entscheidungen über Investitionen oft schneller und besser koordiniert erfolgen.
Wird künstliche Intelligenz auch Chips entwerfen?
KI hilft schon heute beim Chipdesign: beim Entwurf komplexer Architekturen, bei Simulation, Optimierung und automatisierten Tests. Das verkürzt Entwicklungszeiten, erweitert die Möglichkeiten und beschleunigt Experimente, die mit klassischen Methoden
viel Zeit und Ressourcen kosten würden. Ingenieurinnen und Ingenieure werden dadurch nicht ersetzt, sondern können ihre Kreativität auf komplexe, innovative Lösungen konzentrieren, insbesondere in sicherheitskritischen Bereichen. KI ist ein starkes Werkzeug, aber keine Alternative zur menschlichen Expertise.
Wie nachhaltig ist die Chip-Produktion?
Der ökologische Fußabdruck eines Mikrochips kann über den CO2-Impact seiner Herstellung ermittelt werden, also anhand der ausgestoßenen CO2-Menge pro Chipfläche. Aktuell verursacht die Produktion ungefähr 2 kg CO2 pro Qudratzentimeter Chip, wobei dieser Wert stark von der Komplexität des Fertigungsprozesses abhängt. Um die Nachhaltigkeit zu messen und zu verbessern, werden beispielsweise CO2-Footprint-Analysen der Reinräume durchgeführt, in denen die sensiblen Fertigungsprozesse stattfinden. Deren CO2-Fußabdruck ist zu 70 bis 80 Prozent auf den Energieverbrauch zurückzuführen. Dabei entfallen wiederum rund zwei Drittel auf die aufwendige Klima- und Luftfiltertechnik. Deshalb investieren Forschung und Industrie stark in Maßnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs, etwa durch effizientere Klimatisierung oder optimierte Luftströmung.
Gibt es so etwas wie einen „Chip made in Germany“ – und ist das ein Qualitätssiegel?
Ja, es gibt viele „Chips made in Germany“. Infineon produziert in Dresden und Regensburg vor allem Leistungshalbleiter für Automotive und Industrie, während Bosch in Reutlingen und im neuen Dresdner Werk Milliarden MEMS-Sensoren und Automobilelektronik fertigt. Qualität hängt aber weniger vom Ort ab als von Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und Zertifizierung – hier sind deutsche und europäische Hersteller stark. Abhängigkeiten von internationalen Vorprodukten, Maschinen und Spezialmaterialien bleiben jedoch.
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was fasziniert Sie an der Welt der Mikroelektronik?
Mikrochips machen unseren Alltag einfacher, effizienter und sicherer. Sie sind oft unsichtbar, aber unverzichtbar: im Smartphone, im Auto, in der Medizintechnik oder in der Produktion. Faszinierend ist das Tempo, mit dem neue Ansätze wie kognitive
Sensoren oder neuromorphe, also nervensystemähnliche Hardware entwickelt werden. Besonders freut mich die immer engere Zusammenarbeit von Forschung, Industrie und Politik. Wenn Europa seine Souveränität stärkt und eine eigene Innovationskultur lebt, können wir die digitale Zukunft aktiv mitgestalten – Forschung mit Wirkung, nicht nur im Labor.
Quelle: fondsmagazin
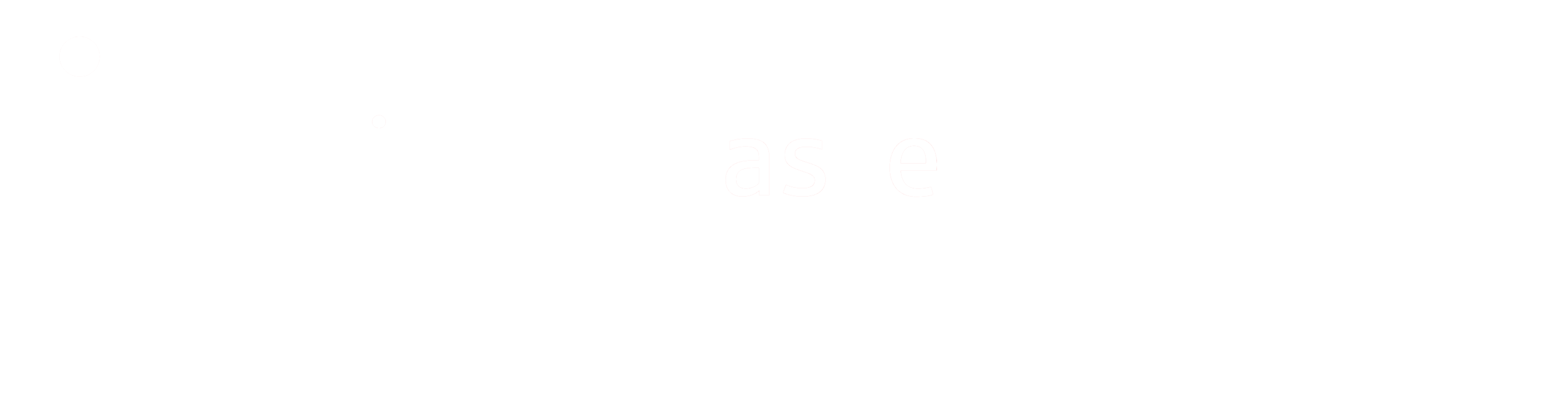






Schreibe einen Kommentar