Dachbodendämmung: Günstig und effektiv sanieren

Geht es um die energetische Sanierung des eigenen Hauses, ist die Dachbodendämmung eine der günstigsten Maßnahmen. Sie lässt sich in vielen Fällen einfach selbst realisieren und senkt den Energieverbrauch spürbar. Neben niedrigeren Heizkosten profitieren Sie aber auch von einem besseren Hitzeschutz, wenn Sie die oberste Geschossdecke dämmen. Wie das funktioniert und wie der Staat die Dachbodendämmung fördert, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.
In diesen Fällen lohnt sich die Dachbodendämmung
Bei der Dachbodendämmung geht es darum, die oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden mit einer Dämmschicht zu versehen. Das reduziert die Wärmeverluste nach oben und spart Heizkosten ein. Neben dem Wärmeschutz im Winter verbessern Sie damit auch den Hitzeschutz im Sommer. Sinnvoll ist die Dämmung daher, wenn der Dachraum nicht beheizt und die oberste Geschossdecke von oben frei zugänglich ist.
Unser Tipp: Planen Sie weitere Sanierungsarbeiten am Haus oder möchten Sie den neuen Dachraum Ihren Wünschen entsprechend ausstatten? Gern unterstützen wir Sie dabei!
GEG verpflichtet zur Dämmung der Geschossdecke
Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt der Gesetzgeber die Dämmung im Bestand vor, sofern die oberste Geschossdecke von oben frei zugänglich ist. Ausnahmen bestehen, wenn bereits eine Dämmung am Dachboden oder am Dach vorhanden ist, wenn sich die Maßnahme nicht rechnet oder dann, wenn Sie als Eigentümer ein Ein- oder Zweifamilienhaus schon am 01. Februar 2002 bewohnt haben. In diesen Fällen sind Sie nach § 47 GEG nicht zur Dachbodendämmung verpflichtet. Wichtig zu wissen: Nach Kauf, Erbe oder Schenkung geht die Pflicht auf die neuen Eigentümer über. Zur Erfüllung haben sie dabei zwei Jahre Zeit.
Verschiedene Möglichkeiten stehen zur Verfügung
Ganz gleich, ob Sie von der Pflicht zur Dachbodendämmung betroffen sind oder die Maßnahme aus freien Stücken planen: In Bezug auf die Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welche dabei zu empfehlen ist, hängt davon ab, ob der Dachboden begehbar sein soll oder nicht.
- Nicht begehbarer Dachboden: In diesem Fall genügt es, Dämmstoffe auf der obersten Geschossdecke auszubringen. Infrage kommen unter anderem Matten aus Mineralwolle oder schüttfähige Dämmstoffe, die sich besonders einfach und kostengünstig lückenlos ausbringen lassen.
- Selten begehbarer Dachboden: Für einen einfachen tragfähigen Boden legen Sie Balken aus, in deren Zwischenräume Sie die Dachbodendämmung einbringen. Verwendet werden können Dämmstoffmatten oder schüttfähige Dämmstoffe. Von oben verlegen Sie anschließend Bohlen mit einem Abstand von etwa drei Zentimeter zueinander. So kann eventuelle Feuchtigkeit entweichen.
- Voll begehbarer Dachboden: Einen voll begehbaren Dachboden erhalten Sie mit einer begehbaren Dachbodendämmung. Diese besteht aus druckfesten Dämmplatten mit Trockenestrich. Alternativ können Sie auch druckfeste Dämmplatten sowie einen Boden aus OSB-Platten verlegen.
Typische Fehler vermeiden: Darauf ist zu achten
Für ein sicheres Ergebnis kommt es bei der Dachbodendämmung auf einen wirksamen Feuchteschutz an. Wird die Dämmebene oben dicht abgeschlossen (zum Beispiel mit einem Bodenbelag), muss unter der Dämmung eine sogenannte Dampfbremse verlegt werden. Besonders geeignet sind feuchtevariable Folien, die ihre Eigenschaften den klimatischen Bedingungen anpassen und Feuchtigkeit abtrocknen lassen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Holzböden fest verschraubt sind und bringen Sie eine Nivellierschicht aus, bevor Sie die Dämmung verlegen. Wichtig ist es darüber hinaus, Dämmmaterialien lückenlos auszubringen und die Belastbarkeit der obersten Geschossdecke zu beachten.
Attraktive Förderung der Dachbodendämmung
Erreichen Sie einen U-Wert von 0,14 W/m2 (ca. 24 cm Dämmung der WLG 035), bekommen Sie eine Förderung für die Dachbodendämmung. Zur Auswahl stehen Steuerboni in Höhe von 20 Prozent der Kosten oder einmalige Zuschüsse in Höhe von 15 bis 20 Prozent. Während Sie die Zuschüsse vor Maßnahmenbeginn mit einem Energieberater beantragen müssen, bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung nachträglich über drei Jahre verteilt auch ohne Berater – vorausgesetzt die Steuerlast ist ausreichend hoch. Die Beauftragung eines Fachhandwerkers ist für den Steuerbonus allerdings Pflicht. Erfüllen Sie die erhöhten Anforderungen an den Wärmeschutz nicht, können Sie nachträglich den Steuerbonus für Handwerkerleistungen nutzen und 20 Prozent der Handwerker-Lohnkosten steuerlich absetzen.
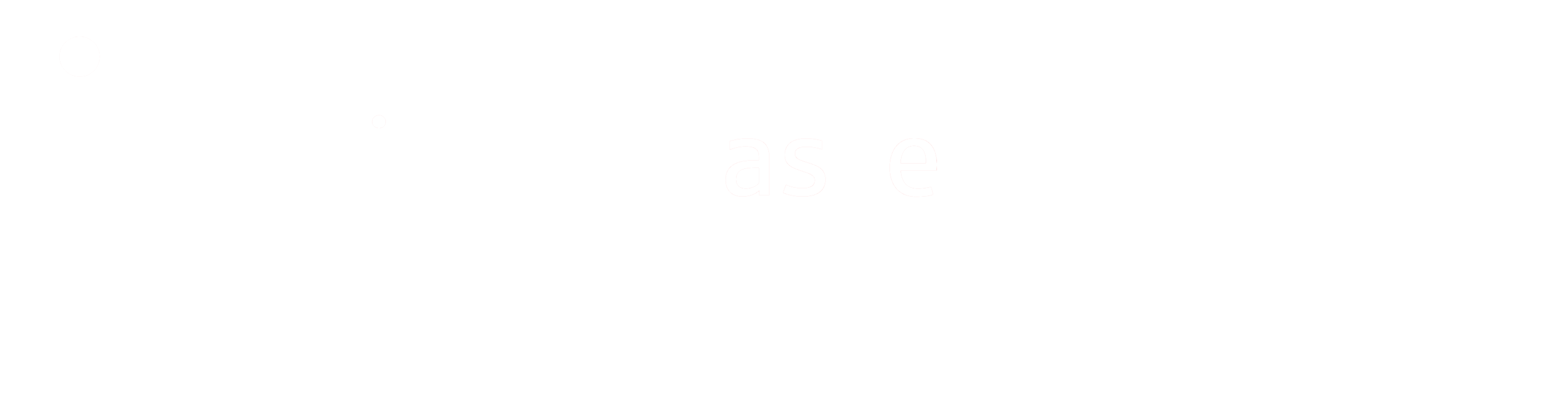






Schreibe einen Kommentar